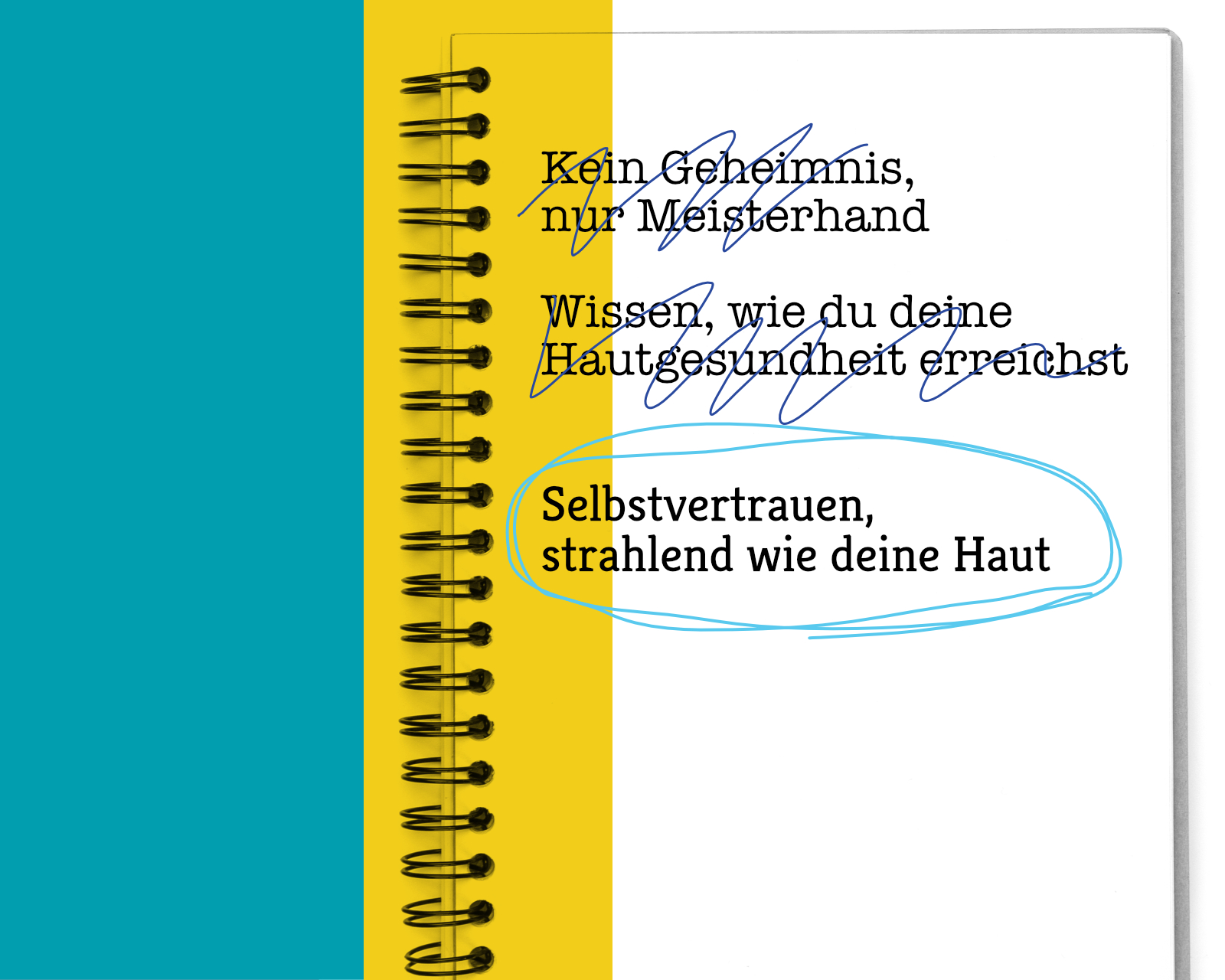Slogan entwickeln: Wie ich als Texterin mit dir zusammenarbeite
rebekka-sommer2023-12-13T20:04:30+01:00Slogans entwickeln: Was ich dir nach 10 Jahren als Texterin mitgeben will Wirksame Slogans und Marketingtexte entstehen nicht einfach so. Sie sind das Ergebnis von kreativen und strategischen Prozessen, die darauf abzielen, die Einzigartigkeit von Organisationen oder Marken in Worte und Sprachbilder zu übersetzen. Mein Job als Texterin ist, im Blick zu haben, dass diese Botschaften klar und konsistent sind. Hier zeige ich dir am Beispiel eines Kosmetikateliers, wie ich mit einer Kundin neue Kernbotschaften und Slogans entwickelte. Mit dem Bauch denken Phase 1 der Slogan-Entwicklung: eintauchen Unsere Zusammenarbeit begann mit einem telefonischen Interview. Gespräche sind für mich wichtig, weil ich dabei in die Welt und in die Sprache meiner Kund*innen eintauche. Durch das Erzählen entsteht eine emotionale Verbundenheit. Beim Zuhören erlebe ich mit, was eine Markenpersönlichkeit im Kern ausmacht. Es geht nicht nur darum, Informationen zu sammeln, sondern vielmehr um das, was zwischen den Zeilen liegt. Viele Ideen für Slogans stammen von den Kund*innen selbst. Nur merken sie oft selbst nicht, wie reich sie an Botschaften und Geschichten sind. Das habe ich schon von vielen anderen Kreativen gehört. Unsere Aufgabe liegt im aufmerksamen Zuhören, Sortieren, Erkennen der verborgenen Nuancen und der Geschichten, die eine Marke authentisch und einzigartig machen. Das sind Beispiele für Fragen, die du in diesem Schritt der Slogan-Entwicklung verwenden kannst: Was erzählst du Freunden über deine Arbeit? Was siehst du mit deinem professionellen Blick, was andere Menschen nicht sehen? Wie fühlt sich deine Zielgruppe, wenn sie von dir beraten wurde? Geschichten entwerfen Phase 2 der Slogan-Entwicklung: lostexten Mit den Erkenntnissen aus meiner Analyse entwickelte ich nun erste Textbausteine und Vorschläge für Slogans. Hier floss meine kreative Interpretation dessen ein, was ich herausgehört hatte. Die Kundin hatte in dem ersten Telefonat viel darüber gesprochen, dass sie im Alltag oft Menschen sehe, die sich selbst nicht darüber bewusst zu sein schienen, wie sie ihren Hauttyp pflegen und ihre charakteristischen Schönheitsmerkmale betonen könnten. Dann würde sie am liebsten mit wenigen kosmetischen Handgriffen aktiv werden. Die ersten Slogan-Vorschläge lauteten: Schönheit heißt, dich selbst erkennen Selbstvertrauen, strahlend wie deine Haut Die Idee dahinter: Eine Marke, die die Selbstakzeptanz ihrer Kund*innen fördert. Natürliche Schönheit liegt nicht in makellosen Oberflächen, sondern in dem, was uns einzigartig macht. Mit ihrem professionellen Know-how tragen die Kosmetiker*innen dazu bei, das zu erkennen und hervorzuheben. Dabei verbinden sie das Wissenschaftliche mit dem Wohlgefühl. Im Zentrum der Kommunikation steht die persönliche Verbindung zwischen Kundin und Atelier. Der (emotionale) Nutzen liegt in einem gesteigerten Selbstbewusstsein durch ein gutes Hautgefühl, Schutz, Nahrung und Regeneration für die Haut. Wow, das bin ich! Dein Selbstbewusstsein trägst du auf der Haut. Schönheit zeigt sich nicht in makellosen Oberflächen, sondern in dem, was dich einzigartig macht. Und das sieht ein geschultes Kosmetikerinnen-Auge, sobald du unser Atelier XXX betrittst. Professionelle Kosmetik verbindet sinnvoll angewandte Technologien mit klassischen Methoden. Hightech und Natürlichkeit? Gehören zusammen. Wir wählen Behandlungsformen