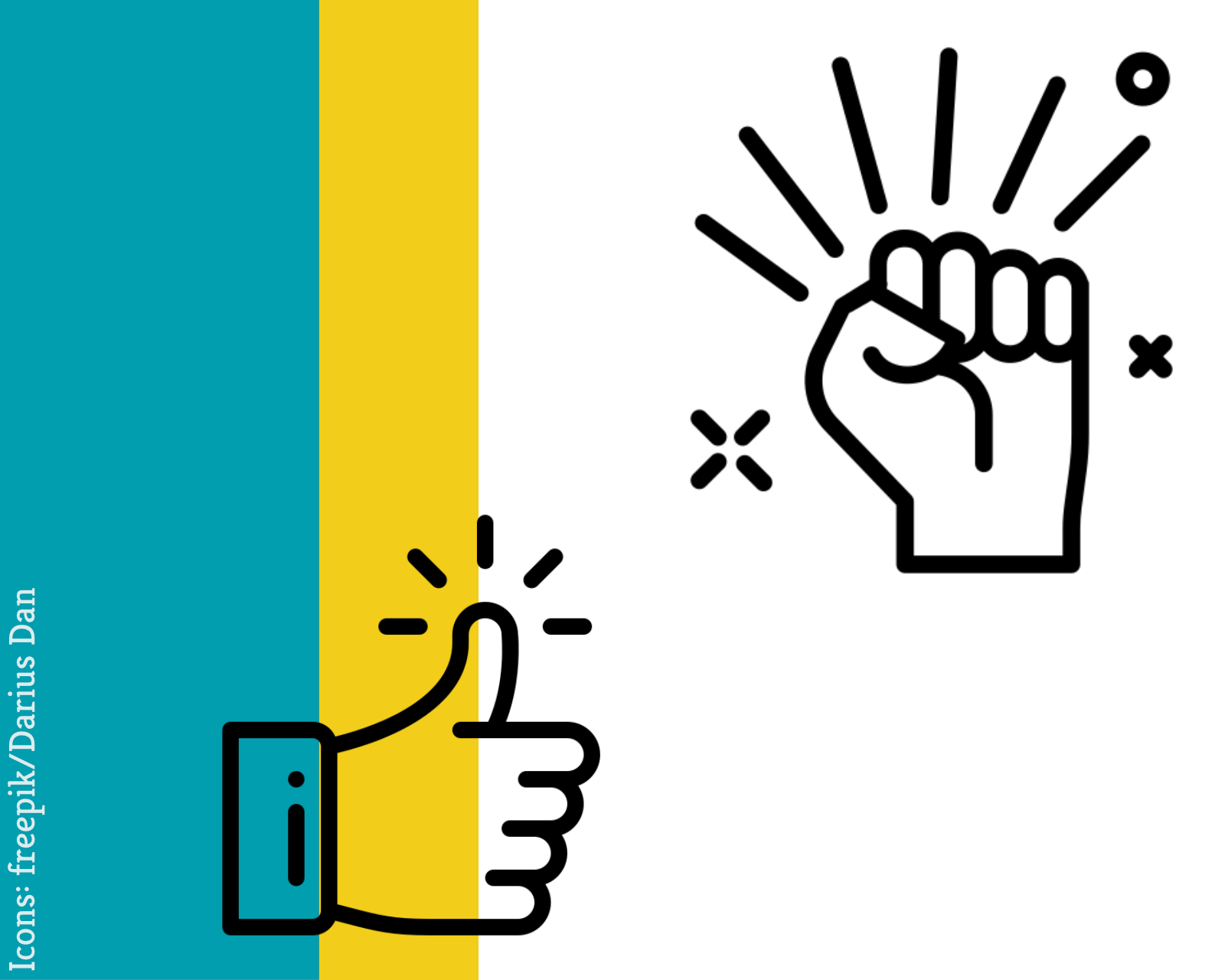Hendrik Epe, Organisationsbegleiter
Alle reden über Purpose, nur die Soziale Arbeit nicht
Im Zeitalter der Sinnsuche ist der Begriff »Purpose« in aller Munde – alle reden darüber, von Agenturen über Startups bis hin zu großen Unternehmen. Doch es gibt ein kleines gallisches Dorf, das sich tapfer gegen den Purpose-Hype stemmt: die Soziale Arbeit. Hendrik Epe, Organisationsbegleiter und Blogger, wirft einen Blick darauf, warum ausgerechnet die Soziale Arbeit, die Sinnstiftung in ihrer DNA trägt, sich schwer damit tut, die notwendigen Veränderungen anzunehmen. Im Interview teilt er seine Gedanken über die Verbindung zwischen »New Work«, »digitale Transformation« und der Sinnhaftigkeit von Sozialer Arbeit.
Hendrik, du hast Soziale Arbeit studiert, bloggst aber über »New Work«, »digitale Transformation« und »Purpose«. Das sind Begriffe, die ich der Sozialen Arbeit gar nicht zuordnen würde, sondern eher der hippen Startup-Szene.
Wie kommt es dazu, dass du diese beiden Welten verbindest?
Hendrik Epe: Ich habe nach meinem Studium einige Zeit in der Jugendhilfe gearbeitet und dann zehn Jahre lang an Hochschulen Qualitätsicherung gemacht. Dabei stellte ich fest, dass „Qualitätssicherung“ wenig mit wirklicher Qualität zu tun hat, sondern dass es eigentlich nur darum geht, die Anforderungen der Zertifizierer zu erfüllen.
Dann begann ich einen Masterstudiengang Sozialmanagement. Und plötzlich war ich damit beschäftigt, klassisch betriebswirtschaftliche Modelle auf soziale Organisationen zu übertragen. Wieder ging es um Qualitätsmanagement, Prozesskostenrechnung, Controlling und so weiter. Und irgendwann wurde in mir der Gedanke immer stärker: „Das kann doch alles keine gute Idee sein.“
Was hat dich daran gestört?
Meine Vorstellung von Sozialer Arbeit war immer menschenzentriert, an den Bedarfen des Klientels orientiert. Aus Sicht des Sozialmanagements erschien Geld aber nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern als eigentlicher Zweck. In den Modellen, die uns da vermittelt wurden, ging es primär darum, Mittel zu generieren, auf die Finanzen zu gucken.
Also hast du dich nach alternativen Theorien umgeschaut?
Genau, ich fing an, mich mit alternativen Organisationslogiken zu beschäftigen. So bin ich unter anderem auf den ehemaligen Unternehmensberater und McKinsey-Partner Frédéric Laloux gestoßen, der in seinem inzwischen berühmten Buch “Reinventing Organisations” beschreibt, wie sinnstiftende Arbeit aussehen kann.
All das, was Frédéric Laloux beschreibt, findet man inzwischen in den häufig als „neu“ bezeichneten alternativen Organisationsszenen. Dazu gehört die Arbeitskultur vieler Startups, der Versuch, „agiler“ zu werden undsoweiter. Das Ganze firmiert unter dem Themenkomplex „New Work“, obwohl der Soziologe Friethjof Bergmann, der den Begriff New Work bereits in den 1980er-Jahren geprägt hat, etwas völlig anderes gemeint hat als Organisationsentwicklung.
Und auch viele etablierte, große Unternehmen setzen ja immer stärker darauf, den Wertekanon in ihrem Inneren transparent zu machen oder sich nach alternativen Prinzipien zu organisieren.
Zum Beispiel?
Ein bekanntes Beispiel ist die Drogerie-Kette dm, wo jede Filiale so selbstorganisiert ist, dass sie bis hin zum Sortiment selbst bestimmt, was sie verkauft. Ähnlich beim französischen Sportartikel-Hersteller Decathlon – dort haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen entscheiden, eine neue Filiale in einem afrikanischen Slum zu eröffnen.
Der Freiburger Ökoversand Triaz GmbH ist seit 2018 ein so genanntes Purpose-Unternehmen: Bei grundlegenden Fragen wie einem Unternehmensverkauf entscheidet nicht die Geschäftsführung, sondern die Purpose-Stiftung. Dahinter steht die Idee, dass Unternehmen sich selbst gehören, und nicht denen, die die Geschäfte führen.
Ende 2019 hörte ich in dem Kontext einen Vortrag des Geschäftsführers von Einhorn, einem fair-veganen Kondomhersteller, über „Verantwortungseigentum„. Und ich dachte mir:
All das, was in der alternativen Unternehmens- und Startup-Szene diskutiert wird, von Selbstorganisation über Ganzheitlichkeit bis zur Sinnstiftung, ist bei uns in der Sozialen Arbeit schon da. Eigentlich.
Eigentlich?
Ja – denn die Werte, die in den Anfängen vieler sozialer Organisationen grundlegend waren, werden heute oft durch klassische betriebswirtschaftliche Logiken überdeckt. Weil wir auf der einen Seite glauben, dass wir diese BWLer-Logik, diese sozialtechnische Denke brauchen. Auf der anderen Seite wird den sozialen Organisationen diese Denke auch aufgezwungen.
Hendrik, du hast Soziale Arbeit studiert, bloggst aber über „New Work“, „digitale Transformation“ und „Purpose“. Das sind Begriffe, die ich der Sozialen Arbeit gar nicht zuordnen würde, sondern eher der hippen Startup-Szene.
Wie kommt es dazu, dass du diese beiden Welten verbindest?
Hendrik Epe: Ich habe nach meinem Studium einige Zeit in der Jugendhilfe gearbeitet und dann zehn Jahre lang an Hochschulen Qualitätsicherung gemacht. Dabei stellte ich fest, dass „Qualitätssicherung“ wenig mit wirklicher Qualität zu tun hat, sondern dass es eigentlich nur darum geht, die Anforderungen der Zertifizierer zu erfüllen.
Dann begann ich einen Masterstudiengang Sozialmanagement. Und plötzlich war ich damit beschäftigt, klassisch betriebswirtschaftliche Modelle auf soziale Organisationen zu übertragen. Wieder ging es um Qualitätsmanagement, Prozesskostenrechnung, Controlling und so weiter. Und irgendwann wurde in mir der Gedanke immer stärker: „Das kann doch alles keine gute Idee sein.“
Was hat dich daran gestört?
Meine Vorstellung von Sozialer Arbeit war immer menschenzentriert, an den Bedarfen des Klientels orientiert. Aus Sicht des Sozialmanagements erschien Geld aber nicht mehr als Mittel zum Zweck, sondern als eigentlicher Zweck. In den Modellen, die uns da vermittelt wurden, ging es primär darum, Mittel zu generieren, auf die Finanzen zu gucken.
Also hast du dich nach alternativen Theorien umgeschaut?
Genau, ich fing an, mich mit alternativen Organisationslogiken zu beschäftigen. So bin ich unter anderem auf den ehemaligen Unternehmensberater und McKinsey-Partner Frédéric Laloux gestoßen, der in seinem inzwischen berühmten Buch “Reinventing Organisations” beschreibt, wie sinnstiftende Arbeit aussehen kann.
All das, was Frédéric Laloux beschreibt, findet man inzwischen in den häufig als „neu“ bezeichneten alternativen Organisationsszenen. Dazu gehört die Arbeitskultur vieler Startups, der Versuch, „agiler“ zu werden undsoweiter. Das Ganze firmiert unter dem Themenkomplex „New Work“, obwohl der Soziologe Friethjof Bergmann, der den Begriff New Work bereits in den 1980er-Jahren geprägt hat, etwas völlig anderes gemeint hat als Organisationsentwicklung.
Und auch viele etablierte, große Unternehmen setzen ja immer stärker darauf, den Wertekanon in ihrem Inneren transparent zu machen oder sich nach alternativen Prinzipien zu organisieren.
Zum Beispiel?
Ein bekanntes Beispiel ist die Drogerie-Kette dm, wo jede Filiale so selbstorganisiert ist, dass sie bis hin zum Sortiment selbst bestimmt, was sie verkauft. Ähnlich beim französischen Sportartikel-Hersteller Decathlon – dort haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach eigenem Ermessen entscheiden, eine neue Filiale in einem afrikanischen Slum zu eröffnen.
Der Freiburger Ökoversand Triaz GmbH ist seit 2018 ein so genanntes Purpose-Unternehmen: Bei grundlegenden Fragen wie einem Unternehmensverkauf entscheidet nicht die Geschäftsführung, sondern die Purpose-Stiftung. Dahinter steht die Idee, dass Unternehmen sich selbst gehören, und nicht denen, die die Geschäfte führen.
Ende 2019 hörte ich in dem Kontext einen Vortrag des Geschäftsführers von Einhorn, einem fair-veganen Kondomhersteller, über „Verantwortungseigentum„. Und ich dachte mir:
All das, was in der alternativen Unternehmens- und Startup-Szene diskutiert wird, von Selbstorganisation über Ganzheitlichkeit bis zur Sinnstiftung, ist bei uns in der Sozialen Arbeit schon da. Eigentlich.
Eigentlich?
Ja – denn die Werte, die in den Anfängen vieler sozialer Organisationen grundlegend waren, werden heute oft durch klassische betriebswirtschaftliche Logiken überdeckt. Weil wir auf der einen Seite glauben, dass wir diese BWLer-Logik, diese sozialtechnische Denke brauchen. Auf der anderen Seite wird den sozialen Organisationen diese Denke auch aufgezwungen.
»Soziale Arbeit trägt Sinnstiftung in ihrer DNA«
Welche Werte meinst du genau?
Freiheit, Selbstorganisation, Problemlösung, Nachhaltigkeit, Sinnstiftung, Empowerment. So viele sozialarbeiterische Methoden und Konzepte sind aus der Haltung entstanden, den Menschen ganzheitlich zu betrachten und Menschen dabei zu helfen, sich selbst zu helfen! Das bio-psycho-soziale Menschenbild zum Beispiel ist ja eben gerade keine Einschränkung auf Medizin oder Biologie, Psychologie oder Recht.
Kannst du Beispiele nennen?
Henry Dunant, der das rote Kreuz gegründet hat, ist ja nicht über das Schlachtfeld gelaufen und hat protokolliert, welche Prozesse er einführen muss – sondern er hat den Menschen geholfen.
Lorenz Werthmann, der Caritas-Gründer, oder Johann Hinrich Wichern, der 1877 in Hamburg das Wichernhaus als „Kinderheilanstalt“ gegründet hat – ihnen ging es immer darum, mit Kopf, Herz und Hand zu helfen. Ganzheitlich. Um eben auch das Herz dabei zu haben.
Oder als aktuelleres Beispiel die Gründung der Lebenshilfe: Nachdem die Nazis jegliche Arbeit mit Menschen mit Behinderung pervertiert hatten, schlossen sich in der Nachkriegszeit Familien mit behinderten Kindern zusammen, um sich gemeinsam zu kümmern. So entstand ein Netzwerk aus kleinen Einheiten an unterschiedlichsten Orten, die völlig selbstorganisiert zusammenfanden. Da gab es keinen Masterplan, kein Organigramm, keine Chefs und Vorgesetzte! Das heißt: Soziale Organisationen in ihren unterschiedlichen Konstellationen tragen in ihrer DNA die Anlagen dafür, die zukünftigen Anforderungen der Arbeitswelt zu bewältigen.
„Es gilt, das Misstrauen der Kostenträger zu überwinden“
Und du stellst in Blogbeiträgen immer wieder fest, dass genau das nicht funktioniert: Gerade soziale Organisationen tun sich offenbar schwer mit den notwendigen Veränderungen wie selbstorganisiertem Arbeiten oder Abbau von Hierarchien, ganz zu schweigen von der digitalen Transformation, die ja essenziell ist, um Zielgruppen in ihren Lebenswelten zu erreichen. Sicher tragen prekäre finanzielle Rahmenbedingungen ihren Teil dazu bei. Aber mal davon abgesehen:
Wie kommt es, dass ausgerechnet der Sozialen Arbeit ihr alternativer, innovativer Kern verloren gegangen ist?
Ob er ganz verloren gegangen ist hoffe ich nicht. Aber in den letzten 25 Jahren hat eine Misstrauenslogik Oberhand gewonnen. Und das auch, weil – das muss man den Einrichtungen selbst auch anlasten – viel Schmu betrieben wurde. Da verschwanden Gelder ohne Nachweis, wohin. Aus öffentlichen Geldern bestehende Budgets wurden verbraten, die man im Nachngang nicht nachvollziehen konnte. Etwas klischeehaft beschrieben hatte der klassische 68er-Sozialarbeiter nunmal mit Finanzthemen nichts zu tun – er wollte helfen. Professionell Wirtschaftfen oder auch Wirkungsmessung waren zu dem Zeitpunkt nicht etabliert.
Als Reaktion darauf haben die Kostenträger – wiederum etwas einfach formuliert – ein Riesen-Bürokratiemonster erschaffen: Projektgelder müssen beantragt werden, Nachweise über das kleinste Schleckeis müssen erbracht werden. Dokumentationspflichten haben überhand genommen und nehmen – bspw. in der Pflege – mehr Zeit ein als die eigentlich Care-Arbeit. Ganz aktuell sehen wir die Entwicklung bei im Kern gut gemeinten Gesetzen wie dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), das die Organisationen an den Rand der Belastungsgrenze führt, da die Bürokratie dahinter enorm ist.
Oder kurz: Staat und Kostenträger misstrauen den sozialen Organisationen erstmal grundsätzlich.
Was wäre die Lösung?
Die Lösung ist, im Aussen steigende Komplexität mit Komplexität innerhalb der Organisationen zu begegnen. Da können neue Organisationsformen, Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und Methoden wie agiles Management mehr als gute Dienste leisten.
Dabei ist wichtig zu betonen: Selbstorganisation bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Selbstorganisation funktioniert nur in klar vorgegebenen Rahmen, genau wie Freiheit immer Verantwortung bedingt.
Mir ist noch wichtig, zu betonen, dass das nur mit hoch professionellem, transparentem Wirtschaften funktioniert.
Anders formuliert: Wir brauchen Strukturen, Prozesse, Rahmenbedingungen in sozialen Organisationen – aber eben so, das sie zur Komplexität Sozialer Arbeit passen.
Hendrik, du stellst in Blog-Beiträgen immer wieder fest, dass genau das nicht funktioniert: Gerade soziale Organisationen tun sich offenbar schwer mit den notwendigen Veränderungen wie selbstorganisiertem Arbeiten oder Abbau von Hierarchien, ganz zu schweigen von der digitalen Transformation, die ja essenziell ist, um Zielgruppen in ihren Lebenswelten zu erreichen. Sicher tragen prekäre finanzielle Rahmenbedingungen ihren Teil dazu bei. Aber mal davon abgesehen:
Wie kommt es, dass ausgerechnet der Sozialen Arbeit ihr alternativer, innovativer Kern verloren gegangen ist?
Ob er ganz verloren gegangen ist hoffe ich nicht. Aber in den letzten 25 Jahren hat eine Misstrauenslogik Oberhand gewonnen. Und das auch, weil – das muss man den Einrichtungen selbst auch anlasten – viel Schmu betrieben wurde. Da verschwanden Gelder ohne Nachweis, wohin. Aus öffentlichen Geldern bestehende Budgets wurden verbraten, die man im Nachngang nicht nachvollziehen konnte. Etwas klischeehaft beschrieben hatte der klassische 68er-Sozialarbeiter nunmal mit Finanzthemen nichts zu tun – er wollte helfen. Professionell Wirtschaftfen oder auch Wirkungsmessung waren zu dem Zeitpunkt nicht etabliert.
Als Reaktion darauf haben die Kostenträger – wiederum etwas einfach formuliert – ein Riesen-Bürokratiemonster erschaffen: Projektgelder müssen beantragt werden, Nachweise über das kleinste Schleckeis müssen erbracht werden. Dokumentationspflichten haben überhand genommen und nehmen – bspw. in der Pflege – mehr Zeit ein als die eigentlich Care-Arbeit. Ganz aktuell sehen wir die Entwicklung bei im Kern gut gemeinten Gesetzen wie dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), das die Organisationen an den Rand der Belastungsgrenze führt, da die Bürokratie dahinter enorm ist.
Oder kurz: Staat und Kostenträger misstrauen den sozialen Organisationen erstmal grundsätzlich.
Was wäre die Lösung?
Die Lösung ist, im Aussen steigende Komplexität mit Komplexität innerhalb der Organisationen zu begegnen. Da können neue Organisationsformen, Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und Methoden wie agiles Management mehr als gute Dienste leisten.
Dabei ist wichtig zu betonen: Selbstorganisation bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will. Selbstorganisation funktioniert nur in klar vorgegebenen Rahmen, genau wie Freiheit immer Verantwortung bedingt.
Mir ist noch wichtig, zu betonen, dass das nur mit hoch professionellem, transparentem Wirtschaften funktioniert.
Anders formuliert: Wir brauchen Strukturen, Prozesse, Rahmenbedingungen in sozialen Organisationen – aber eben so, das sie zur Komplexität Sozialer Arbeit passen.
»Ein bisschen mehr Fokus auf den Purpose könnte sozialen Organisationen nicht schaden«
Und was den Purpose angeht: Sollten Sozialarbeitende unaufgeregt bleiben und das als Hype abtun? Oder in ihrer Kommunikation auf die Sau setzen, die durchs Dorf getrieben wird? Immerhin wildern die ganzen schicken Startups hier im fremden Gebiet: Wenn jemand den Purpose erfunden hat, dann ja wohl die Soziale Arbeit!
Es sind nicht nur die Startups auf Sinsuche, sondern auch etablierte, große Unternehmen setzen im Marketing ganz stark auf die Suche nach einem vielleicht irgendwo verborgenen inneren Wertekanon. Das kommt mir oft sehr „gewollt“ vor: Wo, bitteschön, soll denn jetzt ein Autobauer auf einmal seinen ach so sinnstiftenden „Purpose“ entdecken?
Aber mal unabhängig von der Kommunikation nach außen: Ich finde, dass die Sozialen Organisationen hier echt punkten können, wenn sie nicht versuchen, sich wie Wirtschaftsunternehmen zu verhalten, sondern einfach nur ihren eigenen Spirit, ihren eigenen Zweck, eben ihren „Purpose“ wiederentdecken – wie auch immer man das nennt!
Ich begleite beispielsweise einen kirchlichen Jugendhilfeträger in der Organisationsentwicklung. Wir haben mit einem Blick zurück begonnen: Woher kommt die Organisation? Da erzählen die langjährigen Mitarbeiter*innen mit leuchtenden Augen, wie sie früher mit den Kids in den Wald gegangen sind und spannende, echte Abenteuer erlebt haben, Lagerfeuer, Herausforderungen.
Und jetzt, in der heutigen Zeit, reden sie plötzlich über Dienstwege, Reisekostenabrechnungen, Brandschutz, Unfallschutz, Controlling. Da muss ich sagen: Ein bisschen Fokus auf ihren Purpose könnte nicht schaden.
Wie überzeugst du deine Kunden, in Microcopys zu investieren?
Der Erfolg von digitalen Produkten liegt in ihrer Persönlichkeit. Und das ist eine Gesamtheit von vielen Faktoren, zu der auch die Sprache gehört. Denk doch einfach mal an dein Lieblingsessen und stell dir vor, eine Zutat würde fehlen. Dann wäre es nicht mehr das gleiche Gericht, richtig?
Gute und durchdachte Microcopies sind ganz klar ein Wettbewerbsfaktor. Eine App oder Website kann mehr Erfolg haben, wenn schon das Entwickler-Team schon darauf achtet. Beim UX-Texten geht es darum, wirklich zu verstehen, wie sich die Zielgruppe durch eine Anwendung navigiert und was sie erwartet. So kann zum Beispiel das Wort „Registrieren“ auf einem Button auslösen, dass Menschen einen Bestellvorgang abbrechen, weil es nach Aufwand klingt. Wenn dort statt dessen „Weiter“ steht, ist die Zahl der Registrierungen höher. Letztendlich geht es um die Beziehung zwischen Anwendern und Unternehmen, und die Erfolgsquote lässt sich in Website-Klicks oder sogar in Käufen messen.
Wie siehst du die Zukunft der Microcopys?
Ich bin mir sicher, dass Microcopies und das UX-Texten in spätestens fünf Jahren zur Standardpraxis im Produktdesigns geworden sind. In zehn Jahren haben wir uns dann komplett neuen Aspekten des Produktdesigns zugewandt, um uns von der Konkurrenz abzuheben.
Worum wird es in deinem nächsten Buch gehen?
Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich will mehr über Stimme, Ton und Persönlichkeitsdesign erfahren.
Hendrik Epe, Organisationsbegleiter
Hendrik Epe ist Organisationsbegleiter, Keynotespeaker, Blogger und Impulsgeber zu den Themen Organisationsentwicklung, New Work und digitale Transformation insbesondere in der Sozialen Arbeit. Er bloggt auf: www.ideequadrat.org