
Geza Zopf über die Bedeutung von Sprache im Marketing sozialer Organisationen
»Professionell kommunizieren heißt nicht, intelligent klingen – sondern verstanden werden«
Viele große Marken haben eine eigene Sprache. Und einer, der sie formt, ist Geza Czopf: Er leitet als Creative Director das Büro der Agentur REINSCLASSEN in Baden-Baden, die sich auf Corporate Language spezialisiert hat. Sprache als Chance, um ein starkes, einheitliches Bild in der Öffentlichkeit zu schaffen – ist das ein hilfreicher Marketingansatz für die Soziale Arbeit?
Geza, könntest du dir vorstellen, eine einheitliche Markensprache für die Soziale Arbeit zu entwickeln?
Geza Czopf: Soziale Arbeit, das ist ja ein sehr weites Feld. Es gibt sicherlich nicht „die Soziale Arbeit“, genauso wenig wie es „die Wirtschaft“ oder „die Politik“ gibt. Ich denke deshalb eher an einzelne soziale Organisationen wie beispielsweise die Tafel oder das Kinderhilfswerk. Jede einzelne dieser sozialen Organisationen wäre gut beraten, mit einer einheitlichen Sprache zu sprechen.
Welchen Vorteil hätten soziale Organisationen davon, sich im Marketing stärker mit Sprache auseinanderzusetzen?
Geza Czopf: In der freien Wirtschaft argumentieren wir so: Du musst dein Unternehmen gegenüber anderen abgrenzen, weil der Wettbewerb immer einheitlicher wird. Es ist ja heute fast egal, welchen Joghurt oder welche Versicherung ich verkaufe – es gibt meistens Dutzende andere solcher Produkte von anderen Marken. Oft habe ich heute schlicht und ergreifend keine Alleinstellungsmerkmale mehr.
Im sozialen Bereich buhlen ja inzwischen auch viele Organisationen um Aufmerksamkeit. Wenn du dich mit deinem Produkt nicht abheben kannst, muss es dein Auftritt leisten. Und das geht am besten über Sprache.
Gelingt das nicht genauso gut durch Design oder Bildwelten?
Geza Czopf: Bilder schaffen Emotionen. Aber sie können keine komplexen Zusammenhänge erklären. Und Hand aufs Herz: Die Bildwelten sehen ja heute überall gleich aus, sie stammen auch meistens aus den gleichen Bilddatenbanken. Im sozialen Bereich hast immer diese Bilder von armen Menschen, kranken Menschen, Kindern von allen Kontinenten, Hände, die ineinandergreifen. Was bleibt da noch? Die Sprache!
Eine wiedererkennbare Sprache ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich mit dir mal so und mal so rede, denkst du ja auch: „Der ist komisch.“
Wie entsteht Wiedererkennbarkeit durch Sprache?
Geza Czopf: Durch eine bestimmte Wortwahl, also eine bestimmte Tonalität. Nimm beispielsweise IKEA: Es war eins der ersten Unternehmen, die sich im deutschsprachigen Raum dazu entschied, Kunden zu duzen. Das spiegelt Unkompliziertheit, Nähe und Vertrautheit wider. Die Produkte werden personifiziert durch Namen, die an menschliche Namen erinnern. Der Kern einer Corporate Language ist, die Markenwerte in Sprache zu übersetzen.
Jedes Unternehmen hat sich ja irgendwo aufgeschrieben, was es einzigartig macht. Das sollten Sie in der Sozialen Arbeit auch festhalten: Was wollen wir? Wie wollen wir das erzielen? Was ist der Kern unserer Organisation? Dann können Sie das sprachlich nach außen tragen.
Geza, könntest du dir vorstellen, eine einheitliche Markensprache für die Soziale Arbeit zu entwickeln?
Geza Czopf: Soziale Arbeit, das ist ja ein sehr weites Feld. Es gibt sicherlich nicht „die Soziale Arbeit“, genauso wenig wie es „die Wirtschaft“ oder „die Politik“ gibt. Ich denke deshalb eher an einzelne soziale Organisationen wie beispielsweise die Tafel oder das Kinderhilfswerk. Jede einzelne dieser sozialen Organisationen wäre gut beraten, mit einer einheitlichen Sprache zu sprechen.
Welchen Vorteil hätten soziale Organisationen davon, sich im Marketing stärker mit Sprache auseinanderzusetzen?
Geza Czopf: In der freien Wirtschaft argumentieren wir so: Du musst dein Unternehmen gegenüber anderen abgrenzen, weil der Wettbewerb immer einheitlicher wird. Es ist ja heute fast egal, welchen Joghurt oder welche Versicherung ich verkaufe – es gibt meistens Dutzende andere solcher Produkte von anderen Marken. Oft habe ich heute schlicht und ergreifend keine Alleinstellungsmerkmale mehr.
Im sozialen Bereich buhlen ja inzwischen auch viele Organisationen um Aufmerksamkeit. Wenn du dich mit deinem Produkt nicht abheben kannst, muss es dein Auftritt leisten. Und das geht am besten über Sprache.
Gelingt das nicht genauso gut durch Design oder Bildwelten?
Geza Czopf: Bilder schaffen Emotionen. Aber sie können keine komplexen Zusammenhänge erklären. Und Hand aufs Herz: Die Bildwelten sehen ja heute überall gleich aus, sie stammen auch meistens aus den gleichen Bilddatenbanken. Im sozialen Bereich hast immer diese Bilder von armen Menschen, kranken Menschen, Kindern von allen Kontinenten, Hände, die ineinandergreifen. Was bleibt da noch? Die Sprache!
Eine wiedererkennbare Sprache ist auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich mit dir mal so und mal so rede, denkst du ja auch: „Der ist komisch.“
Wie entsteht Wiedererkennbarkeit durch Sprache?
Geza Czopf: Durch eine bestimmte Wortwahl, also eine bestimmte Tonalität. Nimm beispielsweise IKEA: Es war eins der ersten Unternehmen, die sich im deutschsprachigen Raum dazu entschied, Kund*innen zu duzen. Das spiegelt Unkompliziertheit, Nähe und Vertrautheit wider. Die Produkte werden personifiziert durch Namen, die an menschliche Namen erinnern. Der Kern einer Corporate Language ist, die Markenwerte in Sprache zu übersetzen.
Jedes Unternehmen hat sich ja irgendwo aufgeschrieben, was es einzigartig macht. Das sollten Sie in der Sozialen Arbeit auch festhalten: Was wollen wir? Wie wollen wir das erzielen? Was ist der Kern unserer Organisation? Dann können Sie das sprachlich nach außen tragen.
Mitleids-Masche oder Kampf-Rhetorik?
Soziale Arbeit wird oft als harmlos wahrgenommen: »Die machen was mit Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen.« Viele Menschen wissen gar nicht, dass Soziale Arbeit einen kritischen, politischen Anspruch hat. Dass es darum geht, Strukturen zu verändern, auf politischer Ebene Lobby-Arbeit zu machen.
Sozialarbeiter*innen haben deshalb oft das Gefühl, falsch oder gar nicht öffentlich wahrgenommen zu werden. Wie könnte man durch Sprache klar machen, dass wir diese politische Aufgabe haben?
Geza Czopf: Politische Kommunikation hat ihre eigenen Regeln. Sie ist sehr interessengesteuert. Es gibt bestimmte Mechanismen, die hier greifen: Es gilt, die Sprache zu inszenieren und auf die große Bühne zu bringen. »Inszenieren« heißt, dass du mit einer massenmedienwirksamen Sprache arbeitest, mit Phrasen, großen Bildern, so wie jede politische Rede. Du kannst da nicht mit einer Fachsprache arbeiten!
Meine persönliche Meinung ist allerdings, dass sich Soziale Arbeit mit einer klassischen politischen Sprache keinen Gefallen täte, weil sie zu ausgrenzend ist. Politische Diskurse bauen automatisch Schwarz-Weiß-Schemata auf, weil es darum geht, sich von politischen Gegnern abzugrenzen. Die Stufen der Aggressivität sind sehr unterschiedlich, aber sie schwingen immer mit. Soziale Arbeit braucht vermutlich eher Diskurse, die möglichst viele Menschen und Interessengruppen einschließen. Wir sind hier nicht in einem Bereich wie beispielsweise der Wirtschaft oder Verteidigungspolitik, die eine gewisse Härte brauchen, sondern das Soziale ist ja immer ein emotionales Thema, das die gesamte Gesellschaft berührt. Ich würde darauf achten, das in der Sprache mit möglichst wenig Aggressivität zu tun.
Es gibt in politischen Diskursen aber noch ein anderes Charakteristikum, das interessant sein könnte: Die Deutungshoheit. Das heißt, ich besetze bestimmte Begriffe für mich.
Das tun wir in der Corporate Language auch: Nivea besetzt den Begriff „Pflege“ für sich. Die anderen Kosmetikhersteller wie l’oreal besetzen »Schönheit«, Dove sagt »Natürlichkeit«. Wir nennen das auch »Ein-Wort-Kapital«. Jeder besetzt seine Begriffe, das ist in der Politik auch so. Das müsstest du im sozialen Bereich auch tun, bestimmte Begriffe für dich pachten. Hast du die Deutungshoheit, giltst du automatisch als kompetent.
Könnten das für Soziale Arbeit Begriffe sein wie »Hilfe zur Selbsthilfe«? Oder »Kommunikation«? Ich meine, Sozialarbeitende sind Kommunikationsprofis. Sie sitzen im Gemeinderat und sprechen mit dem Bürgermeister, kommunizieren aber gleichzeitig mit Obdachlosen oder straffälligen Jugendlichen.
Geza Czopf: Hilfe zur Selbsthilfe, das verbinde ich sehr mit Entwicklungszusammenarbeit. Wenn ich das höre, sehe ich Bilder vom Brunnenbau in Afrika vor mir. Man muss aufpassen, dass bestimmte Wendungen nicht schon besetzt sind. Also, vom Gedanken her ja, aber wir müssen schauen, ob man da nicht ein neues Wort findet.
»Kommunikation« passt auch, nur ist mir das Wort zu sperrig, zu akademisch. Da müsste man überlegen, mit welcher Tonalität und Wortwahl nehme ich möglichst viele Menschen aus meiner Zielgruppe mit?
Hilfsorganisationen oder Wohlfahrtsverbände nutzen oft Begriffe wie »Miteinander«, »Zusammensein«, »Gespräche«. Da geht man auf die soft Schiene und versucht, alles Sperrige zu vermeiden. „Wir reden einfach miteinander“. Aber das Prinzip ist richtig: Sich zu überlegen, welche Themenfelder man besetzt – und dann, welche Begriffe man sich da herauszieht.
Soziale Arbeit wird oft als harmlos wahrgenommen: »Die machen was mit Kindern, Jugendlichen, Menschen mit Behinderungen.« Viele Menschen wissen gar nicht, dass Soziale Arbeit einen kritischen, politischen Anspruch hat. Dass es darum geht, Strukturen zu verändern, auf politischer Ebene Lobby-Arbeit zu machen.
Sozialarbeiter*innen haben deshalb oft das Gefühl, falsch oder gar nicht öffentlich wahrgenommen zu werden. Wie könnte man durch Sprache klar machen, dass wir diese politische Aufgabe haben?
Geza Czopf: Politische Kommunikation hat ihre eigenen Regeln. Sie ist sehr interessengesteuert. Es gibt bestimmte Mechanismen, die hier greifen: Es gilt, die Sprache zu inszenieren und auf die große Bühne zu bringen. »Inszenieren« heißt, dass du mit einer massenmedienwirksamen Sprache arbeitest, mit Phrasen, großen Bildern, so wie jede politische Rede. Du kannst da nicht mit einer Fachsprache arbeiten!
Meine persönliche Meinung ist allerdings, dass sich Soziale Arbeit mit einer klassischen politischen Sprache keinen Gefallen täte, weil sie zu ausgrenzend ist. Politische Diskurse bauen automatisch Schwarz-Weiß-Schemata auf, weil es darum geht, sich von politischen Gegnern abzugrenzen. Die Stufen der Aggressivität sind sehr unterschiedlich, aber sie schwingen immer mit. Soziale Arbeit braucht vermutlich eher Diskurse, die möglichst viele Menschen und Interessengruppen einschließen. Wir sind hier nicht in einem Bereich wie beispielsweise der Wirtschaft oder Verteidigungspolitik, die eine gewisse Härte brauchen, sondern das Soziale ist ja immer ein emotionales Thema, das die gesamte Gesellschaft berührt. Ich würde darauf achten, das in der Sprache mit möglichst wenig Aggressivität zu tun.
Es gibt in politischen Diskursen aber noch ein anderes Charakteristikum, das interessant sein könnte: Die Deutungshoheit. Das heißt, ich besetze bestimmte Begriffe für mich.
Das tun wir in der Corporate Language auch: Nivea besetzt den Begriff „Pflege“ für sich. Die anderen Kosmetikhersteller wie l’oreal besetzen »Schönheit«, Dove sagt »Natürlichkeit«. Wir nennen das auch »Ein-Wort-Kapital«. Jeder besetzt seine Begriffe, das ist in der Politik auch so. Das müsstest du im sozialen Bereich auch tun, bestimmte Begriffe für dich pachten. Hast du die Deutungshoheit, giltst du automatisch als kompetent.
Könnten das für Soziale Arbeit Begriffe sein wie »Hilfe zur Selbsthilfe«? Oder »Kommunikation«? Ich meine, Sozialarbeitende sind Kommunikationsprofis. Sie sitzen im Gemeinderat und sprechen mit dem Bürgermeister, kommunizieren aber gleichzeitig mit Obdachlosen oder straffälligen Jugendlichen.
Geza Czopf: Hilfe zur Selbsthilfe, das verbinde ich sehr mit Entwicklungszusammenarbeit. Wenn ich das höre, sehe ich Bilder vom Brunnenbau in Afrika vor mir. Man muss aufpassen, dass bestimmte Wendungen nicht schon besetzt sind. Also, vom Gedanken her ja, aber wir müssen schauen, ob man da nicht ein neues Wort findet.
»Kommunikation« passt auch, nur ist mir das Wort zu sperrig, zu akademisch. Da müsste man überlegen, mit welcher Tonalität und Wortwahl nehme ich möglichst viele Menschen aus meiner Zielgruppe mit?
Hilfsorganisationen oder Wohlfahrtsverbände nutzen oft Begriffe wie »Miteinander«, »Zusammensein«, »Gespräche«. Da geht man auf die soft Schiene und versucht, alles Sperrige zu vermeiden. »Wir reden einfach miteinander«. Aber das Prinzip ist richtig: Sich zu überlegen, welche Themenfelder man besetzt – und dann, welche Begriffe man sich da herauszieht.
Zum Zuhören bewegen
Angenommen, ich bin Sozialarbeiterin im Bereich der Integration von Geflüchteten und sehe in meiner Gemeinde, dass einfach nicht genügend getan wird, das Team ist völlig unterbesetzt. Welche Sprache müsste ich sprechen, um etwas zu bewirken?
Geza Czopf: Na ja. Das hängt auch wieder von der Zielgruppe ab. Als Integrationshelferin könntest du sagen: »Wir machen das hier mit viel Herzblut, wir geben alles, aber wir sind zu wenig, weil …« Und dieses »zu wenig« hat ja Ursachen, das kann alles Mögliche sein – von »zu wenig Anerkennung« bis »zu wenig Entlohnung«.
Wenn ich einen Appell an die Politik richte, werde ich einen anderen Sprachgebrauch haben, als wenn ich eine Benefiz-Aktion ausrichte und sie bewerbe. Da würde ich wieder sehr soft argumentieren und die Vorteile der Integration für alle herausstellen. Der Politik werde ich vorrechnen: Was hat der Staat von mir und was bekomme ich im Gegenzug? Da muss ich genau auf meine Zielgruppe achten, mit wem spreche ich. Der Tonfall wird ein anderer sein.
Fällt dir außer Sozialer Arbeit noch ein anderes Beispiel ein für »politische Kommunikation, die dennoch emphatisch ist«?
Geza Czopf: In meiner Laufbahn hatte ich einmal den Auftrag, Broschüren der FDP zur Entwicklungszusammenarbeit zu überarbeiten. Da war schnell klar, dass es ein sehr sensibles Thema war. Es ging um sauberes Trinkwasser, Bildungschancen, Kinder und Ernährung – da brauchte es eine sehr behutsame Wortwahl. Weil auch klar war: Hier gibt es ja eigentlich keine zweite Meinung.
Immer wenn sich Themen um Soziales drehen – also um Menschen, um bedürftige Menschen – versuchen wir, eine besonders emphatische Wortwahl an den Tag zu legen. Da geht es nicht um harte politische Entscheidungen. Natürlich geht es auch um Geld, aber es ist nochmal was anderes, als wenn ein Land in die EU aufgenommen werden soll, da kann ich Für und Wider abwägen, so wie in vielen anderen haushaltspolitischen Entscheidungen auch.
Wenn man sich Bundestagsdebatten anschaut, sind die Debatten sehr auf Pro und Contra orientiert. Man setzt seine eigene Position durch und diffamiert den Gegner oder setzt ihn herab. Wenn es jedoch um ganz sensible Bereiche geht, die das Leben betreffen, oder Gesetze, die es betreffen, dann werden auch die strengsten Hardliner recht sanft. Bei Sterbehilfe oder Organspende – also immer da, wo man sagt, man macht keine Witze mehr drüber –, werden die Reden oft mit persönlichen Erlebnissen ausgeschmückt. Dann wird es sachlich und man versucht, die Meinung des anderen auch wirklich zu reflektieren. Das ist im Sozialen Bereich meiner Meinung nach das Wichtige: Dass man sagt, du kannst so oder so dazu stehen, ich respektiere deine Meinung – aber überlege noch mal an dem und dem Punkt.
Wir hatten mal einen Auftrag im Bereich Organspende. Das ist ein so sensibles Thema, dass man die Menschen eigentlich gar nicht mehr auffordern will, direkt etwas zu tun. Denn das ist ja eine typische »Gefahr«, das ich gleich zur Kasse gebeten werden, hier soll ich spenden, da soll ich spenden. Deshalb wenden sich viele Menschen bei sozialen Themen gleich von vornherein ab. Wir haben bei unserer Kampagne zur Organspende deshalb so argumentiert: »Du musst gar nichts tun. Uns reicht es aus, wenn du zuhörst und dich zwei oder drei Minuten mit dem Thema beschäftigt. Denn hier geht es um Dinge, an die du im Alltag oft nicht denkst, die dich aber betreffen könnten. Wir wollen dich nicht belästigen, denn du hast viel um die Ohren und kannst dich nicht mit den ganzen Problemen deiner Nachbarschaft beschäftigen. Aber manchmal reicht es schon aus, wenn es Menschen gibt, die über eine Situation einfach Bescheid wissen.«
Natürlich war das nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir wollten natürlich erreichen, dass Menschen Geld spenden und sich aktiv beteiligten. Aber der Einstieg war ein anderer – und das hat mit »Empathie« zu tun. Das ist ein Wort, das ich lieber mag als »Sympathie«. Sympathisch findet jeder etwas anderes. Bei Empathie geht es um Einfühlungsvermögen. Das ist in der Sprache eins der schwierigsten Dinge.
»Mach dich nicht wichtig – mach dein Thema wichtig!«
Soziale Arbeit kreist in meiner Wahrnehmung sehr stark um ihre eigene Professionalisierung. Es geht auch darum, als eigene wissenschaftliche Disziplin wahr- und ernstgenommen zu werden. Das führt – wie in anderen Sozialwissenschaften – oft zu einer sehr komplexen, abstrakten Sprache.
Das entspricht in etwa dem Dilemma der Business-to-Business-Kommunikation: Man möchte unter Fachleuten nicht das Gesicht verlieren, indem man zu einfach und emotional kommuniziert. Gleichzeitig wollen wir verstanden werden. Wie gelingt ein guter Mittelweg?
Geza Czopf: Wir erleben in jedem Corporate-Language-Prozess dasselbe: Wer auf Fachebene mit Fachleuten spricht, muss Fachbegriffe verwenden. Denn Ärzte sagen untereinander nun mal nicht »Durchfall«, sondern »Diarrhö«. Das ist ein Zeichen von Expertise. Jeder Bereich hat seine Fachsprache, egal ob Jäger, Mediziner, Linguisten oder Angler. Das ist ein Zeichen der Zugehörigkeit. Hier reden wir wirklich von Fachsprache.
Dann gibt es eine hochgestochene pseudo-wissenschaftliche Intellektuellensprache. Im Management ist es dieses Bullshit-Bingo. Politiker nutzen das, um zu verschleiern, und auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es das zu Hauf. Das ist aber nur Schaumschlägerei, man will dem anderen nur kenntlich machen, du hast keine Ahnung. Hier erleben wir, dass die Menschen das immer weniger akzeptieren. Wissenschaftler, Politiker oder Wirtschaftsleute, die ständig so reden, werden oft enttarnt und immer seltener ernst genommen. Da sind die Leute heute mündiger als früher und lassen sich das nicht mehr bieten. Von dieser offensichtlichen Schaumschlägerei würde ich definitiv die Finger lassen. Wir wissen, dass Menschen, die sich einfach ausdrücken können, für intelligenter gehalten werden als solche, die nur Bla Bla von sich geben.
Wenn ich zu einem Arzt gehe und der mit mir seine Fachsprache spricht, verstehe ich den nicht. Und da verliere ich Vertrauen. Denn entweder denke ich, er hält mich für dumm – oder er will kenntlich machen, dass er intelligent und ich dumm bin. Oder er will mir nicht reinen Wein einschenken. Ich würde immer zu einem Arzt gehen, den ich verstehe. Also: Wenn du zu Laien sprichst, dann gewöhne dir die Fachsprache ab. Die Menschen haben heute nicht mehr die Zeit und die Lust, Wörter nachzuschlagen.
Professionell zu kommunizieren heißt nicht, intelligent zu klingen. Sondern immer so, dass die anderen mich verstehen.
In einem Seminar habe ich mal gelernt: Eigentlich muss ich mein Gegenüber meine Botschaft nochmal in eigene Worte fassen – erst dann weiß ich, ob er mich verstanden hat. Nur dann kann Kommunikation ankommen. Oft redet man aneinander vorbei.
Wir müssen verstehen, dass sich das Professionelle auch in der Emotion zeigt. Professionell kommunizieren heißt nämlich, dass ich von möglichst vielen Menschen aus meiner Zielgruppe verstanden werde.
Und das Emotionale ergibt sich dann fast von alleine. Ich sage immer: Schreib, wie du sprichst! Die gesprochene Sprache kommt immer vor der schriftlichen. Das ist das Ursprüngliche, was wir haben. Und dann werde ich automatisch emotional, denn dann spreche ich in Bildern, dann lasse ich abstrakte Wörter weg, dann spreize ich den kleinen Finger nicht ab – dann mache ich mich nicht wichtig, sondern ich mache das Thema wichtig.
Du bist automatisch emotional in deiner Sprache! Und wenn dir ein Thema wichtig ist, merkt man beim Sprechen, dass du ihm Nachdruck verleihst. Indem du Beispiele schilderst. Aber nicht, indem du akademische Formeln ausbreitest. All denen, die keine rhetorische Schulung absolviert haben, kann ich sagen: Sag es genau so wie du es deiner Oma erzählen würdest. Später kannst du nochmal drüber schauen, ob die Kernbotschaft stimmt.
Gerade in Interviews mit Politiker kommen oft so vorgestanzte O-Töne. Und kaum ist das Mikro aus, fallen die besten Sätze. Aber wenn wir etwas sagen wollen, dann müssen wir es tun, auch in der Politik.
Die markantesten Sätze sind immer die, die mit einem Bild hinterlegt sind: Die »blühenden Landschaften« von Helmut Kohl. Die Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passen muss. Das sind Bilder, die Jahre später noch hängen bleiben – und zwar, weil es den Menschen wirklich ein Anliegen war, das genauso zu benennen.
Soziale Arbeit kreist in meiner Wahrnehmung sehr stark um ihre eigene Professionalisierung. Es geht auch darum, als eigene wissenschaftliche Disziplin wahr- und ernstgenommen zu werden. Das führt – wie in anderen Sozialwissenschaften – oft zu einer sehr komplexen, abstrakten Sprache.
Das entspricht in etwa dem Dilemma der Business-to-Business-Kommunikation: Man möchte unter Fachleuten nicht das Gesicht verlieren, indem man zu einfach und emotional kommuniziert. Gleichzeitig wollen wir verstanden werden. Wie gelingt ein guter Mittelweg?
Geza Czopf: Wir erleben in jedem Corporate-Language-Prozess dasselbe: Wer auf Fachebene mit Fachleuten spricht, muss Fachbegriffe verwenden. Denn Ärzt*innen sagen untereinander nun mal nicht »Durchfall«, sondern »Diarrhö«. Das ist ein Zeichen von Expertise. Jeder Bereich hat seine Fachsprache, egal ob Jäger, Mediziner, Linguisten oder Angler. Das ist ein Zeichen der Zugehörigkeit. Hier reden wir wirklich von Fachsprache.
Dann gibt es eine hochgestochene pseudo-wissenschaftliche Intellektuellensprache. Im Management ist es dieses Bullshit-Bingo. Politiker*innen nutzen das, um zu verschleiern, und auch im wissenschaftlichen Bereich gibt es das zu Hauf. Das ist aber nur Schaumschlägerei, man will dem anderen nur kenntlich machen, du hast keine Ahnung. Hier erleben wir, dass die Menschen das immer weniger akzeptieren. Wissenschaftler*innen, Politiker*innen oder Wirtschaftsleute, die ständig so reden, werden oft enttarnt und immer seltener ernst genommen. Da sind die Leute heute mündiger als früher und lassen sich das nicht mehr bieten. Von dieser offensichtlichen Schaumschlägerei würde ich definitiv die Finger lassen. Wir wissen, dass Menschen, die sich einfach ausdrücken können, für intelligenter gehalten werden als solche, die nur Bla Bla von sich geben.
Wenn ich zu einem Arzt gehe und der mit mir seine Fachsprache spricht, verstehe ich den nicht. Und da verliere ich Vertrauen. Denn entweder denke ich, er hält mich für dumm – oder er will kenntlich machen, dass er intelligent und ich dumm bin. Oder er will mir nicht reinen Wein einschenken. Ich würde immer zu einem Arzt gehen, den ich verstehe. Also: Wenn du zu Laien sprichst, dann gewöhne dir die Fachsprache ab. Die Menschen haben heute nicht mehr die Zeit und die Lust, Wörter nachzuschlagen.
Professionell zu kommunizieren heißt nicht, intelligent zu klingen. Sondern immer so, dass die anderen mich verstehen.
In einem Seminar habe ich mal gelernt: Eigentlich muss ich mein Gegenüber meine Botschaft nochmal in eigene Worte fassen – erst dann weiß ich, ob er mich verstanden hat. Nur dann kann Kommunikation ankommen. Oft redet man aneinander vorbei.
Wir müssen verstehen, dass sich das Professionelle auch in der Emotion zeigt. Professionell kommunizieren heißt nämlich, dass ich von möglichst vielen Menschen aus meiner Zielgruppe verstanden werde.
Und das Emotionale ergibt sich dann fast von alleine. Ich sage immer: Schreib, wie du sprichst! Die gesprochene Sprache kommt immer vor der schriftlichen. Das ist das Ursprüngliche, was wir haben. Und dann werde ich automatisch emotional, denn dann spreche ich in Bildern, dann lasse ich abstrakte Wörter weg, dann spreize ich den kleinen Finger nicht ab – dann mache ich mich nicht wichtig, sondern ich mache das Thema wichtig.
Du bist automatisch emotional in deiner Sprache! Und wenn dir ein Thema wichtig ist, merkt man beim Sprechen, dass du ihm Nachdruck verleihst. Indem du Beispiele schilderst. Aber nicht, indem du akademische Formeln ausbreitest. All denen, die keine rhetorische Schulung absolviert haben, kann ich sagen: Sag es genau so wie du es deiner Oma erzählen würdest. Später kannst du nochmal drüber schauen, ob die Kernbotschaft stimmt.
Gerade in Interviews mit Politiker*innen kommen oft so vorgestanzte O-Töne. Und kaum ist das Mikro aus, fallen die besten Sätze. Aber wenn wir etwas sagen wollen, dann müssen wir es tun, auch in der Politik.
Die markantesten Sätze sind immer die, die mit einem Bild hinterlegt sind: Die »blühenden Landschaften« von Helmut Kohl. Die Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passen muss. Das sind Bilder, die Jahre später noch hängen bleiben – und zwar, weil es den Menschen wirklich ein Anliegen war, das genauso zu benennen.
Ich – Zielgruppe – bin die Krise?!
Ich – Zielgruppe – bin die Krise?!
Geza, als Alleinerziehende war ich immer wieder auch Zielgruppe von Sozialer Arbeit. Ich habe beispielsweise als Studentin einmal Geld aus einer Stiftung bekommen, um ein Praktikum mit Kinderbetreuung in einer anderen Stadt zu finanzieren.
Mit diesem Betroffenen-Blick fiel mir immer wieder auf, das die Sprache sozialer Organisationen mich oft eher abschreckte. Ein Beispiel: Ich suchte nach einer Mutter-Kind-Kur – und wurde auf der Website eines Familienhilfswerk mit den Worten empfangen, dass die »Institution Familie in einer Krise steckt«, weil es »immer mehr Alleinerziehende« gibt. Das heißt: Ich – Zielgruppe – bin die Krise?! Was, bitteschön, ist das denn für eine Sprache?
Oft wird auch unterschieden zwischen »Familien« und »Alleinerziehenden«, so als ob ich mit meiner Tochter keine Familie wäre. Dabei sind Sozialarbeiter*innen doch im echten Leben so emphatisch in ihrer Kommunikation. Warum ist das in der Öffentlichkeitsarbeit so anders?
Geza Czopf: So etwas passiert, wenn man versucht, einem Thema gerecht zu werden, indem man es intelligent klingen lässt. Ich vermute, dass die Menschen in solchen Fällen die Wichtigkeit betonen wollen. Aber sie setzen es falsch um: in einem Stil, der seriös klingt. Das Seriöse kommt dann oft in unpassenden Formulierungen.
Natürlich muss man gucken, wer der Absender ist. Die katholische Kirche wird Familienstrukturen natürlich anders beschreiben als Pro Familia. Das gesellschaftspolitische Spektrum ist ja sehr breit. Aber wenn ich »Institution Familie« höre, dann habe ich schon das Gefühl, jemand will mich in eine bestimmten Ecke treiben. Das macht man oft ganz unbewusst und ist nicht böse gemeint, denn jeder hat seine Vorstellungen über das Zusammenleben in der Gesellschaft oder wie eine Familie auszusehen hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man muss schon aufpassen, wenn man den Text noch einmal durchliest: Lasse ich da eine politische Anschauung, ein Weltbild einfließen? Geht es bei dem Angebot einer Mutter-Kind-Kur überhaupt darum, veränderte Familienstrukturen zu thematisieren? Oder ist nicht vielmehr das Thema, dass Eltern – ob allein oder zu zweit – in einer bestimmten Konstellation einfach nicht mehr über die Runden kommen und eine Auszeit brauchen?
Ich würde hier eher konkrete Fälle beschreiben: Was beschäftigt die Person XY im Hier und Jetzt, warum braucht sie Unterstützung. Sonst läuft man Gefahr, die Situation der Betroffenen in Frage zu stellen: »Warum hat die denn auch zwei Kinder?!« Das Emotionale in der Sprache kommt nicht aus dem Ausschmücken der Umstände, sondern aus der Sache selbst heraus. Das stärke ich sogar, indem ich mich zurückhalte und nüchtern und faktisch schreibe, Adjektive zurückhalte. Wir wollen keine Oliver Twist Romane, kein Mitleid. Da rennen dir die Leute weg. Das ist eine Frage der Wortwahl. Es ist aber ein schmaler Grat, das gebe ich ganz ehrlich zu: Mache ich die Dinge zu klein? Oder mache ich sie zu groß?
Ein zweites Beispiel, auch aus meiner Lebenswelt als Alleinerziehende: Die Caritas hat vor einigen Jahren mit einem Video versucht, locker-flockig herüberzukommen, um junge Mütter auf Social Media anzusprechen. Dabei rutschte die Sprecherin in eine so unpassende Tonalität hinein, dass viele Alleinerziehende eher das Gefühl hatten, verschaukelt zu werden. Es gab darin Tipps wie »Nimm dir doch mal’n heißes Bad und tu dir was Gutes« oder »Keine Angst vor wenig Geld, es gibt ja Sozialleistungen«.
Es gab einen Shitstorm, das Video ist aber bis heute online. Das Argument der Macher*innen war, dass es das brauche für junge Zielgruppen und auf Social Media. Aus meiner Sicht geht es aber auch um Deutungshoheiten: Wer spricht wie über wen? Bis heute habe ich nicht verstanden, weshalb sich die Caritas so an diesem unsäglichen Video festbeißt und es nicht einfach aus dem Netz genommen hat.
Was sagst du dazu: Brauchen wir verschiedene Tonalitäten je nach Zielgruppe oder für unterschiedliche Kanäle?
Geza Czopf: Nein. Wenn ich meine Tonalität festgelegt habe, ist sie für alle Zielgruppen gleich. Sonst habe ich keine Corporate Language mehr. Das ist einfach so. Das sagen wir immer auch wieder unseren Kunden: Wenn du eine Tonalität festgelegt hast, musst du sie durchziehen.
Ich würde bei solchen sensiblen Themen raten, faktenbasiert zu erzählen. Kürzlich sah ich auf RTL eine Reportage über alleinerziehende Eltern in Berlin. Es ging darum, wer es sich in Deutschland überhaupt noch erlauben kann, im Sommer in den Urlaub zu fahren. Das war eine beachtliche Zahl: ein Drittel der deutschen Kinder verbrachte die Sommerferien zu Hause – und zwar nicht im Schwimmbad, weil das Geld fehlte, sondern auf dem Spielplatz, denn der ist umsonst und hoffentlich bleibt er das auch.
An diesem Bericht fand ich wirklich gut, dass nicht die Armut ausgeschmückt wurde, sondern die Macher einfach die Eltern und Kinder haben sprechen lassen. Trotzdem ist die Netto-Botschaft hängen geblieben: „Ein Drittel kann nicht reisen.“ Das war hochgradig emotional. Ich habe dort keine unglücklichen oder weinenden Kinder gesehen. Man hat sie gesehen, so wie sie eben sind.
Darüber macht man sich viel mehr Gedanken, weil es eben ein Bericht ist und kein Betroffenheitsding. Auch, weil ich dadurch kein schlechtes Gewissen kriege. Denn das führt dazu, dass die Menschen sich zurückziehen: »Die wollen mir einreden, dass ich schuld bin, weil ich in die Karibik fliege. Bevor ich meinen dicken Mercedes verkaufe, mache ich lieber das Garagentor runter, dann sieht ihn keiner.«
Aber es gibt kein Patent-Rezept. Kommunikation heißt, man versucht immer sein Bestes. Letztendlich ist die Gesellschaft komplexer, als man denkt. Leider können wir nicht in die Köpfe unserer Zielgruppen reinschauen. Manchmal führt etwas zum Erfolg und ein andermal ist man ganz überrascht, dass es gar nicht ankommt. Das geht uns in der Kommunikation auch immer wieder so, dass wir denken, wir hätten alles richtig gemacht – und dann reagieren die Menschen doch anders.
Geza, als Alleinerziehende war ich immer wieder auch Zielgruppe von Sozialer Arbeit. Ich habe beispielsweise als Studentin einmal Geld aus einer Stiftung bekommen, um ein Praktikum mit Kinderbetreuung in einer anderen Stadt zu finanzieren.
Mit diesem Betroffenen-Blick fiel mir immer wieder auf, das die Sprache sozialer Organisationen mich oft eher abschreckte. Ein Beispiel: Ich suchte nach einer Mutter-Kind-Kur – und wurde auf der Website eines Familienhilfswerk mit den Worten empfangen, dass die »Institution Familie in einer Krise steckt«, weil es »immer mehr Alleinerziehende« gibt. Das heißt: Ich – Zielgruppe – bin die Krise?! Was, bitteschön, ist das denn für eine Sprache?
Oft wird auch unterschieden zwischen »Familien« und »Alleinerziehenden«, so als ob ich mit meiner Tochter keine Familie wäre. Dabei sind Sozialarbeiter*innen doch im echten Leben so emphatisch in ihrer Kommunikation. Warum ist das in der Öffentlichkeitsarbeit so anders?
Geza Czopf: So etwas passiert, wenn man versucht, einem Thema gerecht zu werden, indem man es intelligent klingen lässt. Ich vermute, dass die Menschen in solchen Fällen die Wichtigkeit betonen wollen. Aber sie setzen es falsch um: in einem Stil, der seriös klingt. Das Seriöse kommt dann oft in unpassenden Formulierungen.
Natürlich muss man gucken, wer der Absender ist. Die katholische Kirche wird Familienstrukturen natürlich anders beschreiben als Pro Familia. Das gesellschaftspolitische Spektrum ist ja sehr breit. Aber wenn ich »Institution Familie« höre, dann habe ich schon das Gefühl, jemand will mich in eine bestimmten Ecke treiben. Das macht man oft ganz unbewusst und ist nicht böse gemeint, denn jeder hat seine Vorstellungen über das Zusammenleben in der Gesellschaft oder wie eine Familie auszusehen hat. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man muss schon aufpassen, wenn man den Text noch einmal durchliest: Lasse ich da eine politische Anschauung, ein Weltbild einfließen? Geht es bei dem Angebot einer Mutter-Kind-Kur überhaupt darum, veränderte Familienstrukturen zu thematisieren? Oder ist nicht vielmehr das Thema, dass Eltern – ob allein oder zu zweit – in einer bestimmten Konstellation einfach nicht mehr über die Runden kommen und eine Auszeit brauchen?
Ich würde hier eher konkrete Fälle beschreiben: Was beschäftigt die Person XY im Hier und Jetzt, warum braucht sie Unterstützung. Sonst läuft man Gefahr, die Situation der Betroffenen in Frage zu stellen: »Warum hat die denn auch zwei Kinder?!« Das Emotionale in der Sprache kommt nicht aus dem Ausschmücken der Umstände, sondern aus der Sache selbst heraus. Das stärke ich sogar, indem ich mich zurückhalte und nüchtern und faktisch schreibe, Adjektive zurückhalte. Wir wollen keine Oliver Twist Romane, kein Mitleid. Da rennen dir die Leute weg. Das ist eine Frage der Wortwahl. Es ist aber ein schmaler Grat, das gebe ich ganz ehrlich zu: Mache ich die Dinge zu klein? Oder mache ich sie zu groß?
Ein zweites Beispiel, auch aus meiner Lebenswelt als Alleinerziehende: Die Caritas hat vor einigen Jahren mit einem Video versucht, locker-flockig herüberzukommen, um junge Mütter auf Social Media anzusprechen. Dabei rutschte die Sprecherin in eine so unpassende Tonalität hinein, dass viele Alleinerziehende eher das Gefühl hatten, verschaukelt zu werden. Es gab darin Tipps wie »Nimm dir doch mal’n heißes Bad und tu dir was Gutes« oder »Keine Angst vor wenig Geld, es gibt ja Sozialleistungen«.
Es gab einen Shitstorm, das Video ist aber bis heute online. Das Argument der Macher*innen war, dass es das brauche für junge Zielgruppen und auf Social Media. Aus meiner Sicht geht es aber auch um Deutungshoheiten: Wer spricht wie über wen? Bis heute habe ich nicht verstanden, weshalb sich die Caritas so an diesem unsäglichen Video festbeißt und es nicht einfach aus dem Netz genommen hat.
Was sagst du dazu: Brauchen wir verschiedene Tonalitäten je nach Zielgruppe oder für unterschiedliche Kanäle?
Geza Czopf: Nein. Wenn ich meine Tonalität festgelegt habe, ist sie für alle Zielgruppen gleich. Sonst habe ich keine Corporate Language mehr. Das ist einfach so. Das sagen wir immer auch wieder unseren Kunden: Wenn du eine Tonalität festgelegt hast, musst du sie durchziehen.
Ich würde bei solchen sensiblen Themen raten, faktenbasiert zu erzählen. Kürzlich sah ich auf RTL eine Reportage über alleinerziehende Eltern in Berlin. Es ging darum, wer es sich in Deutschland überhaupt noch erlauben kann, im Sommer in den Urlaub zu fahren. Das war eine beachtliche Zahl: ein Drittel der deutschen Kinder verbrachte die Sommerferien zu Hause – und zwar nicht im Schwimmbad, weil das Geld fehlte, sondern auf dem Spielplatz, denn der ist umsonst und hoffentlich bleibt er das auch.
An diesem Bericht fand ich wirklich gut, dass nicht die Armut ausgeschmückt wurde, sondern die Macher*innen einfach die Eltern und Kinder haben sprechen lassen. Trotzdem ist die Netto-Botschaft hängen geblieben: „Ein Drittel kann nicht reisen.“ Das war hochgradig emotional. Ich habe dort keine unglücklichen oder weinenden Kinder gesehen. Man hat sie gesehen, so wie sie eben sind.
Darüber macht man sich viel mehr Gedanken, weil es eben ein Bericht ist und kein Betroffenheitsding. Auch, weil ich dadurch kein schlechtes Gewissen kriege. Denn das führt dazu, dass die Menschen sich zurückziehen: »Die wollen mir einreden, dass ich schuld bin, weil ich in die Karibik fliege. Bevor ich meinen dicken Mercedes verkaufe, mache ich lieber das Garagentor runter, dann sieht ihn keiner.«
Aber es gibt kein Patent-Rezept. Kommunikation heißt, man versucht immer sein Bestes. Letztendlich ist die Gesellschaft komplexer, als man denkt. Leider können wir nicht in die Köpfe unserer Zielgruppen reinschauen. Manchmal führt etwas zum Erfolg und ein andermal ist man ganz überrascht, dass es gar nicht ankommt. Das geht uns in der Kommunikation auch immer wieder so, dass wir denken, wir hätten alles richtig gemacht – und dann reagieren die Menschen doch anders.
Dann geht es darum, im Gespräch zu bleiben?
Ja, und zu reflektieren, was ist falsch gelaufen. In diesen sensiblen Bereichen empfinden Menschen Sprache sehr unterschiedlich. So abgedroschen das auch klingen mag: Wichtig ist, den Diskurs aufrecht zu erhalten. Das ist das ganz Wichtige.
Das ist – am Rande gesprochen – ein gesamtgesellschaftliches Problem, das überhaupt nicht mehr gelingt, wenn ich mir die politische Großwetterlage momentan in Deutschland anschaue (Anm.: Das Interview wurde Ende 2020 geführt). Mein Gefühl ist, dass die Menschen daran gar kein Interesse mehr haben. Man spricht immer von der Spaltung der Gesellschaft. Ich habe aber nicht das Gefühl, das irgendeine Seite das Interesse hat, die Gräben zuzuschütten. Ganz im Gegenteil, man feuert jetzt mit allem, was man hat, auf die gegnerischen Parteien los. Das darf eigentlich nicht passieren.
So sozialpädagogisch abgedroschen das auch klingen mag: Man muss im Gespräch mit »den Anderen« sein. Denn danach kommt nur noch die Keule.
Das Magazin über Soziale Arbeit, Marketing und Sprache
Dann geht es darum, im Gespräch zu bleiben?
Ja, und zu reflektieren, was ist falsch gelaufen. In diesen sensiblen Bereichen empfinden Menschen Sprache sehr unterschiedlich. So abgedroschen das auch klingen mag: Wichtig ist, den Diskurs aufrecht zu erhalten. Das ist das ganz Wichtige.
Das ist – am Rande gesprochen – ein gesamtgesellschaftliches Problem, das überhaupt nicht mehr gelingt, wenn ich mir die politische Großwetterlage momentan in Deutschland anschaue (Anm.: Das Interview wurde Ende 2020 geführt). Mein Gefühl ist, dass die Menschen daran gar kein Interesse mehr haben. Man spricht immer von der Spaltung der Gesellschaft. Ich habe aber nicht das Gefühl, das irgendeine Seite das Interesse hat, die Gräben zuzuschütten. Ganz im Gegenteil, man feuert jetzt mit allem, was man hat, auf die gegnerischen Parteien los. Das darf eigentlich nicht passieren.
So sozialpädagogisch abgedroschen das auch klingen mag: Man muss im Gespräch mit »den Anderen« sein. Denn danach kommt nur noch die Keule.

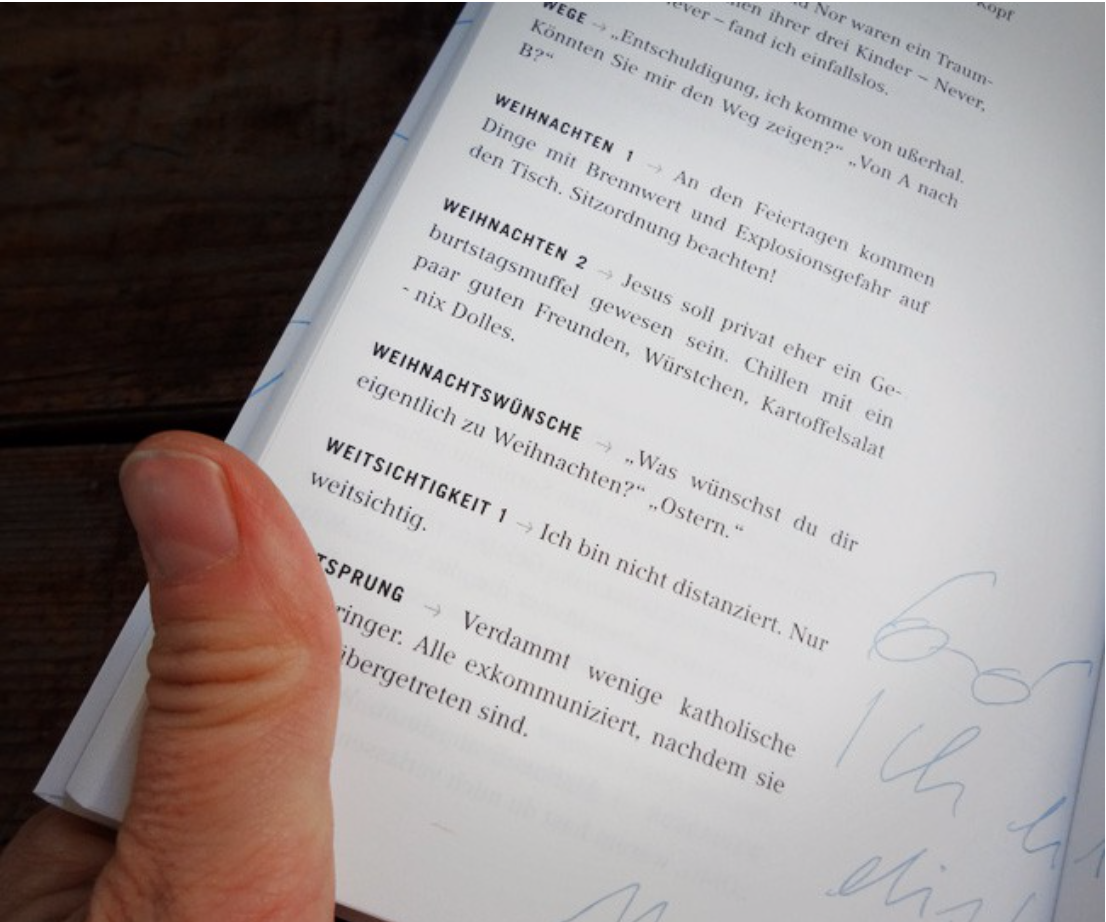
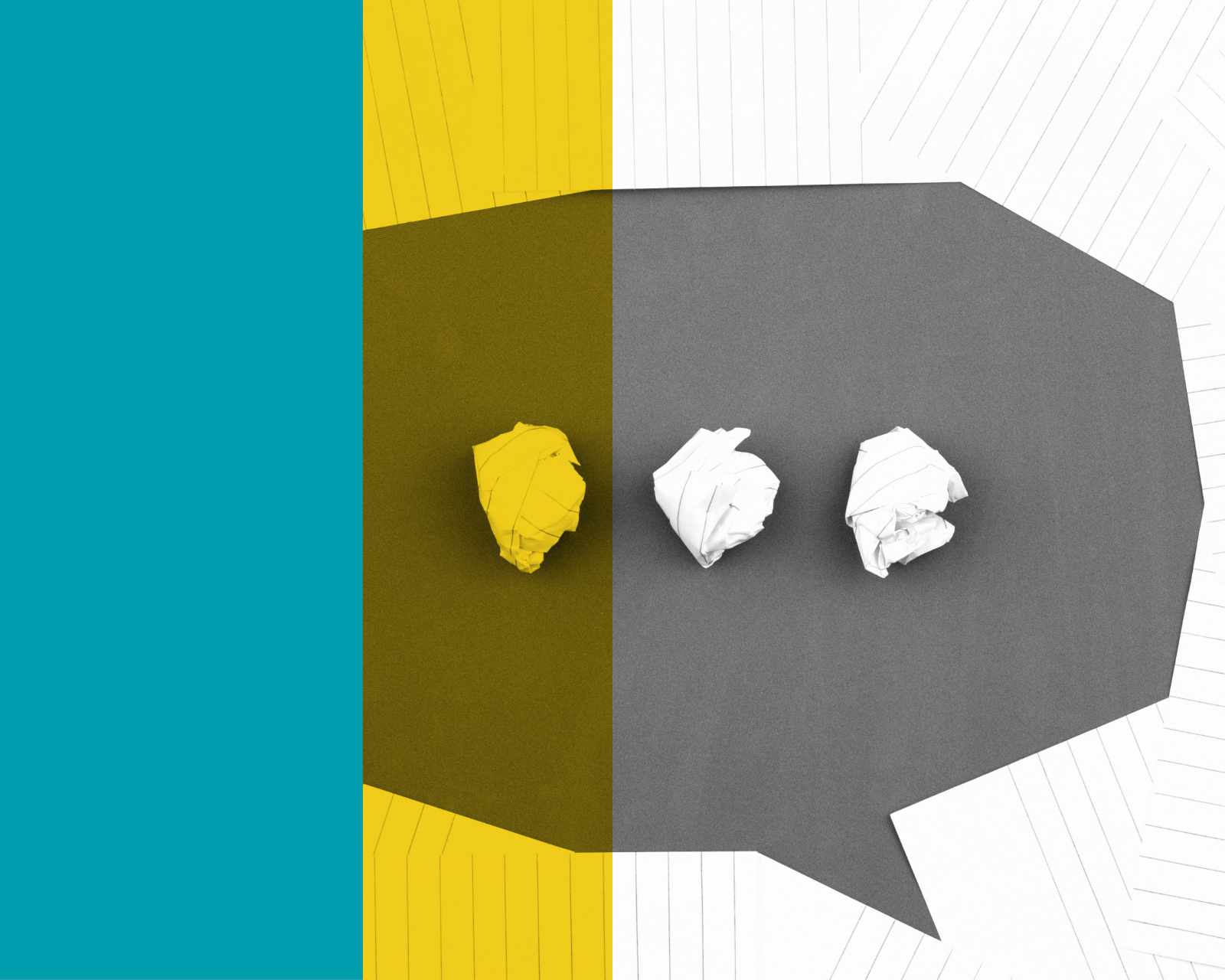

Tolles Interview!
Und das Ende: hochaktuell!